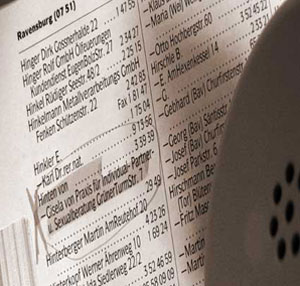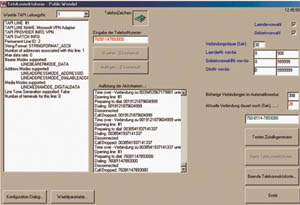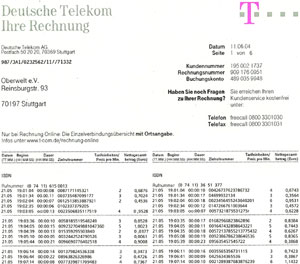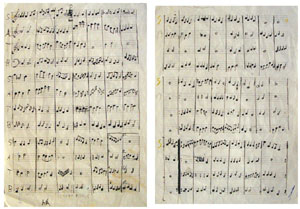|

Elke Hennen: Alice im Wunderland


Außenansicht: In Farbe gekratzte Gucklöcher am Fenster



oben: Blick durch die Löcher auf "Alice im Wunderland"
Akteure: Elke Hennen und Stefan Schell
unten: Jan Löchte

Bild: Der Förster im Silberwald

Ton: Emmanuelle, synchron nachgesprochen von Jan Löchte

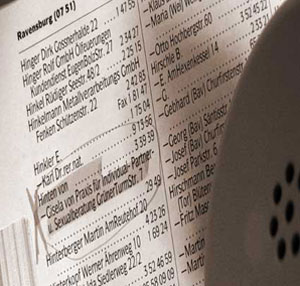
Abb. oben: Details Jan Löchte
Abb unten: Pablo Wendel


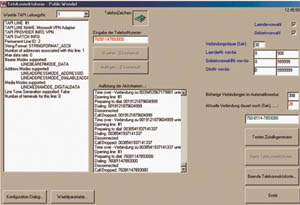
Screenshot des Programms
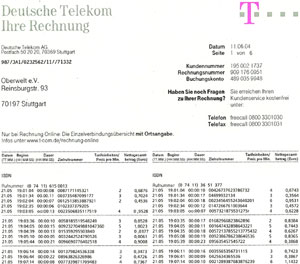
Abb. unten: Heide Spieth-Wolpert

Heide Spieth-Wolpert: Schlaflager

Heide Spieth-Wolpert: Betonkissen
unten: Rosa Rücker: Ananasinstallation



Rosa Rücker: Musik im oberen, abgetrennten Raum
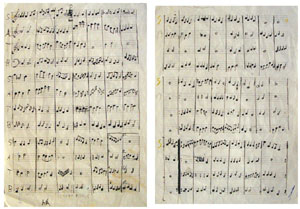
Rosa Rücker: Noten
unten: Lena Röth

Lena Röth: 2 Räume + 11 Häuser + 10 Stimmen = 1 Raum
Klanginstallation mit 11 Häusern aus Pappe


|
täglich
frisch
Elke
Hennen, Jan Löchte, Rudolf Reiber, Pablo Wendel, Verena Frank, Heide
Spieth, Rosa Rücker, Frank Maier, Lena Röth
english version
Das Konzept der Ausstellung
besteht darin, dass der Galerieraum täglich wechselnd von jeweils
einem/einer Studenten/in der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste,
betreut von Alexandra Ranner, für die Dauer von 24 Stunden bespielt
wird. In diesen 24 Stunden sind der Abbau der vorangegangenen Ausstellung,
anfallende Transporte, eventuelle Sanierung der Wände und schließlich
der Aufbau der neuen Ausstellung inbegriffen. Die Ausstellung wird im
Block stattfinden, das heißt, es werden neun Einzelausstellungen
(dies ist die Anzahl der Projekt -Teilnehmer) vorgeführt und folglich
wird auch jeden Abend eine Eröffnung veranstaltet.
Während es in der Studienzeit meist üblich ist, die eigene Arbeit
im Rahmen einer Gruppenausstellung zu präsentieren, soll dieses Projekt
jeden/jede Studenten/in mit der Aufgabe konfrontieren, den jeweils gleichen
Raum alleine zu bespielen. Natürlich sind die Ergebnisse, wegen der
jeweil individuell subjektiven Sicht- und Herangehensweise jedes Künstlers
sehr unterschiedlich.
Die Termine waren:
Dienstag 18.5.: Elke Hennen „Alice im Wunderland“
Mittwoch 19.5.: Jan Löchte „Förster der Lust –
Augenblicke im Leben eines Passanten“
Donnerstag 20.5.: Rudolf Reiber „Verantwortung und Sicherheit“
Freitag 21.5.: Pablo Wendel „Telekonnektophonie“
Samstag 22.5.: Verena Frank „Shift“
Sonntag 23.5.: Heide Spieth-Wolpert „Zwischenwelten“
Montag 24.5.: Rosa Rücker „Ananas“, „Konzert“
Dienstag 25.5.: Frank Maier „Handycap“
Mittwoch 26.5.: Lena Röth „Sprach-Räume“
Kontakt: Jan Löchte 0170-4053391 / Rudolf Reiber 0179-982720
Es erschien ein Katalog in Kooperation mit der Kunstakademie. Hier
der Text von Veranstalterseite
T.ä.gl.i.ch.fr.i.sch
Als ein von Künstlerinnen und Künstlern betriebener Ausstellungs-
und Veranstaltungsraum hat Oberwelt e.V. (unter anderem) ein Interesse
an der Hinterfragung gängiger Kunstvermittlung und einer Untersuchung
alternativer Möglichkeiten der Präsentation.
Eigene Erfahrungen des Teams mit Betrieb und Markt begründen unser
Anliegen, über eine pragmatische Programmveranstaltung hinaus vorwiegend
nicht etablierte künstlerische Alltagspraxis zu diskutieren.
Das Motto „täglich frisch“ verrät zunächst
keinen künstlerischen Inhalt und wirkt vielleicht eher wie ein
etwas sarkastischer Rückzug auf studentische Anonymität und
einen rein formalen Anspruch von überengagierter Abwechslung im
Angebot.
Bis in die Presse-Erklärung hinein bekannte sich die Gruppe offensiv
zum studentischen Status und zur akademischen Betreuung durch die Dozentin
Alexandra Ranner, die während der letzten zwei Semester als Gastprofessorin
die „Klasse für Installation, Performance und Video“
unterrichtete und um die herum sich das Projekt formierte, ohne seine
Identität auf ein hierarchisches Verhältnis zur Lehrenden
zu beschränkt zu sehen, sondern wohl – nach wiederholten
Vakanzen des Lehrstuhls – eine, die Suche nach Lehrverhältnissen
betreffend, eher nomadische Situation gewohnt.
Wo verbirgt sich aber aus Oberwelt-Sicht der Gewinn im Sinne einer Verschränkung
von Studium und Selbstbestimmung – dem Ziel von Selbstorganisation?
- Auf jeden Fall wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich
die volle und jeweils alleinige Verantwortung für den ganzen Ausstellungsraum
übernehmen und dabei – wie im exakten Gegensatz zu einem
Passus im Vertrag der Arbeit „Ästhetik“ von Rudolf
Reiber – auf ihre Bildrechte nicht verzichten, sondern für
sie einstehen können.
- Dafür bot die Gruppe an, schnell zu machen und im Block aufzutreten:
9x Aufbau, Eröffnung und Renovierung jeweils im Komplettpaket in
24 Stunden.
Oberwelt verlangte daraufhin im Vorfeld individuelle Bewerbungen mit
einem Rückblick auf realisierte Arbeiten und dezidierte Konzeptbeschreibungen.
Die Beteiligten ließen sich mit großem Einsatz auf diese
erste Phase ein, bauten sogar ein Oberweltmodell, in dem in kleinem
Maßstab mehrere Installationen realisiert und fotografisch anschaulich
gemacht wurden. Entgegen kam uns dabei natürlich, dass die Räumlichkeiten
durchgehend auf hohem bildnerischen Niveau und großzügig
bespielt zu werden versprachen.
Dennoch bestand die Gruppe Oberwelt gegenüber auf einer Bewerbung
als Gruppe. Die Verbindlichkeit des internen Diskussionsprozesses unter
den Teilnehmenden wurde über etwaige Einwände des Veranstalterkollektivs
und gegen eine Vereinzelung von außen gestellt. Man könnte
darin auch ein Prinzip der internen Solidarität erkennen. Bereits
hier meinte ich jedenfalls eine leistungsorientierte aber gleichzeitig
partnerschaftliche Qualität in der Auffassung von Studium oder
Kunstpraxis zu spüren, die sich dann im praktischen Ablauf der
schon aufgrund ihrer Dynamik charmanten Staffel fortsetzte.
Das kleine Festival der täglich frischen Eröffnungen rückte
den Produktionsprozess in den Mittelpunkt und konnte auch für den
regelmäßigen Besucher als ein im besten Sinne akademisches
Studium der Kunst funktionieren, indem es eine große Konzentration
auf die Einzelpositionen ermöglichte und ohne thematisch einengenden
Rahmen ein weites Spektrum von Ansätzen zeigte.
Bei aller nach außen gerichteten Kraft der einzelnen Arbeiten
stellte dabei meines Erachtens die nach innen abstrahlende Kommunikation
– z.B. bei den Übergaben und den füreinander gehaltenen
Reden – einen wichtigen Mehrwert des Projektes dar und ließ
„täglich frisch“ zu einem Ereignis werden, in dem künstlerische
Autonomie und emanzipatorisch angelegter Kulturbetrieb glücklich
zusammenfanden.
Peter Haury
Jan Löchte zu "Förster der Lust"
, Videoperformance
Hauptbestandteile der Arbeit sind zwei Filme. Der erste Film ist “Der
Förster vom Silberwald”, ein Heimatfilm aus dem Jahr 1954,
den ich als Kind zusammen mit meiner Oma gesehen habe. Der zweite Film,
“Emmanuelle” von 1974, ist ein Erotikfilm, der erste große
Kinoerfolg in diesem Genre, und ich sah diesen Film als meine erste
Erfahrung mit dem Thema Erotikfilm; ich war vielleicht zwölf Jahre
alt und klebte zusammen mit meinem Bruder vorm Fernseher.
“Förster der Lust” ist die Mischung aus den tonlosen
Bildern des Heimatfilms
mit den nachgesprochenen Dialogen des Erotikfilms. Filme sind auch immer
Ausdruck einer Zeit und es ist daher kein Wunder, dass in den Heimatfilmen
vor allen Dingen großartige Natur- und Tieraufnahmen gezeigt werden,
die
sich um eine eher einfache Handlung reihen. Im “Förster vom
Silberwald” ist
das die Liebe zwischen der jungen Wiener Künstlerin Liesl und dem
Förster
Hubert. “Emmanuelle” propagiert dagegen eine Überzeugung
die erst nach 1968 öffentlich so möglich war. Sätze wie
“Die Ehe ist eine Fessel die man
abstreifen muss” bedeuten ein neues individuelles Selbstverständnis
mit einem Privatleben, das nicht mehr an die vormals gültigen Normen
gebunden ist, und die liberalen Auswirkungen dieser neuen Vorstellungen
sind bis heute geblieben. Die Filmfigur Emmanuelle reist zu ihrem Mann,
einem französischen Diplomaten, nach Bangkog und lernt dort durch
eine Art Initiation, dass die Liebe nicht für ein Leben zu zweit
bestimmt ist, sondern dass das Ziel die körperliche Erfüllung
und die entsprechende Geisteshaltung ist. Besucher der Ausstellung waren
vielleicht etwas verwundert, denn ich stand vor der Galerie und sprach
die Dialoge aus “Emmanuelle” nach. Das sah zwar aus wie
ein Selbstgespräch, wirklich jedoch wurde das Gesprochene in die
Galerie übertragen, wo es zu den Bildern des Heimatfilms erscholl
und mit diesem ein neues Gebilde ergab. Dort hatte der Besucher die
Chance den Ursprung von Text und Bild zu erkennen, wenn er eine an der
Wand befestigte Konsole genauer ansah; denn während auf der Konsole
recht offensichtlich ein altes Filmbegleitheft zum “Förster
vom Silberwald” lag, wurde beim Blick unter die Oberfläche
klar, dass der Sockel der Konsole aus dem Pappschuber des Emmanuellefilms
gefertigt war.
"Augenblicke im Leben eines Passanten", C-Prints, 2004, je
22,5 x 30 cm
Fotografien von Auffälligkeiten beim Gang durch die Stadt
Die Lust am Zweideutigen bleibt. Manchmal lauf ich durch die Stadt,
komm am
Nagelstudio vorbei und muss einfach grinsen. Drei Fenster weiter ist
gerade
Mittagspause. Im Fenster hängt ein Zettel “Komme gleich wieder”.
Unwillkürlich kommt mir der Witz in den Sinn: Kommt eine Frau beim
Arzt,
meint der Arzt: “Kommen Sie bald wieder”. Ein Freund aus
England, der mich
besuchte und plötzlich einen Lachanfall wegen meines Tabaks mit
dem Aufdruck “Milde Shag” bekam, weil Shag im Englischen
“Fick” bedeutet. Kurze
Irritationen, eigentlich ernst gemeint und korrekt ausgedrückt,
dennoch
unbeabsichtigt doppeldeutig und manchmal ungewollt komisch. Es liegt
eben
alles im Auge des Betrachters.
Pablo Wendel
Telekonnektofonie
Mit Hilfe von zwei simultan geschalteten Computern, werden jeweils Ziffernkombinationen
als Telefonnummern ins Telefonnetz geschickt. Die gewählten Anschlüsse
sind über den gesamten Erdball verstreut und werden miteinander
verbunden. Im Gegensatz zum bewussten direkten Anwählen einer Verbindung
regelt hier ein Zufallsgenerator die Nummernauswahl und übernimmt
somit die Vermittlerrolle zwischen zwei angerufenen Stellen. Die Generatoren
werden hiermit zum aktiven Part, der zwei passive Empfänger konnektiert.
Da die Verbindung zeitlich auf 30 Sekunden begrenzt ist, entsteht eine
sich permanent neu aufbauende Spannung. Die Installation ist akustisch
verstärkt erlebbar und läuft autark ohne jeglichen Eingriff
ab.
Durch eine geringe Trefferquote ist es relativ unwahrscheinlich,
aber nicht auszuschließen, dass zwischen zwei Angerufenen eine
„echte Kommunikation“ entsteht. Es geht dabei nicht nur
um die tatsächliche verbale Kommunikation, die im vermeintlichen
Bewusstsein, der Abnehmer oder antwortenden Geräte entsteht, vielmehr
ist es die Verbindung selbst, die fasziniert. Im alltäglichen Fall
ist eine Verbindung nur Mittel zum Zweck, wir sind interessiert an dem
was unser Gesprächspartner zu sagen hat. Anders ist es hier: die
Dauer einer Verbindung währt gerade lang genug um eben diese kurz
aufzubauen. Es ist hier weniger von Wichtigkeit, was die angewählten
Punkte miteinander zu tun haben, sondern dass zwischen ihnen ein Kontakt
hergestellt wird. Es entstehen internationale zufallsbedingte Verknüpfungen
mit unvorhersehbaren menschlichen und vor allem technischen Prämissen,
die kulturell interessante Gegenüberstellung ermöglichen können
und den Besucher voyeuristisch daran teilhaben lassen.
Die Arbeit bleibt formal auf einem sehr nüchternen Niveau: zwei
Tische, zwei Computer. Von künstlerischem Interesse sind lediglich
die zwei Bildschirmoberflächen. Was dort zu sehen ist, ist eine
Art Membran des gerade noch Darstellbaren zwischen der haptischen, körperlichen,
empirisch wahrnehmbaren Welt und der den Einblick und Zugriff verwehrenden
Welt der elektronischen Daten unserer selbstverständlich darauf
angewiesenen Realität.
Rosa Rücker zu "Ananas":
Einmal, da habe ich die Schale einer Ananas, die ich mit meiner Familie
gegessen hatte, draußen in der Sonne trocknen wollen.
Da hab ich sie, die einzelnen Stücke, vorsichtig und dann sorgfältig
aufgefädelt. Und dann hingen sie in der Sonne, wiegten im Wind
und ich sah ihnen dabei zu und merkte, dass ich es gerne tat, und, dass
mich dieses Bild berührte.
Aber es war Sommer.
Und ich hatte es vorher schon erlebt, die Sommerluft, und das liegt
vielleicht an der Wärme, bindet die Geräusche, bindet, und
alles scheint stärker zu Leben als sonst.
Rosa Rücker zu "Konzert":
Da sind diese Noten. Ich hab sie irgendwann geschrieben, als Kind, weil
ich dachte, komponieren kann ja nicht so schwer sein. Man schreibt Noten
auf und denkt sich was dabei.
Was ich dabei dachte weiß ich nicht mehr.
Aber wie klingen sie?
Das frag ich mich seit dem.
Lena Röth:
11 Häuser
2 Räume
grosse Häuser, kleine Häuser
laute, stille, verquere, klare, lange, verwinkelte
1 Haus ohne Fenster
Wo ist die Tür?
Schwarze Fenster, wie Löcher
Blupp
Weisse Wände
Stimmen
Der Schrei eines Kindes
Die Stimme eines Mannes, der von Liebe spricht
Ein sanftes Lied
Klacken von Schuhen
„ Ach Lenchen... „
der Text eines Kinderbuches
Stille
Das Kläffen eines Hundes
Der verzweifelte Schrei eines Mannes
Lachen
Eine Frauenstimme „ ...ging leer aus, ging in der Stadt umher...
„
Ein „ Du machst mich wahnsinnig ! „ WAHN-Sinn, neben einem
Lachen, dass aus Häusern dringt, die Geschichten erzählen
und Erinnerungen die dich suchen gehen in der Stille eines Sprachgewirrs,
dass sich im Raum ausbreitet.
Fresh
Daily: An Installation Every Evening, 9 X
Elke Hennen, Jan Löchte, Rudolf Reiber, Pablo Wendel, Verena
Frank, Heide Spieth, Rosa Rücker, Frank Mailer, Lena Marie Röth
The concept of the exhibition is that, in a 24 hour cycle, the exhibition
space will be made available to a different student of the Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste, under the care of Alexandra Ranner.
These 24 hours will involve dismantling the previous exhibition, transport
of works, repair of the walls where necessary, and finally the setting
up of the new exhibition. The exhibitions will be held on successive days,
i.e. nine solo exhibitions will take place (the number of the project
participants), with an opening every evening.
While it is usual for students to present their works in group exhibitions,
this project challenges each student to fill the same space on their own.
The results will naturally, because of the individual subjective perspective
and approach of each particular student, be very diverse.
Pablo Wendel
“Telekonnektophonie“
Two computers, triggered by two random number generators, simultaneously
send number combinations as phone numbers into the international telephone
network and connect destinations from all over the world. The aim is not
the actual verbal communication that is created in the consciousness of
the destinations and the recipients of the phone calls, rather it is the
connection that is fascinating.
After the installation the mechanism operates independently, without any
additional input. International, random connections are created with unpredictable
human as well as technical conditions without any relationship-generating
goals because the connection is limited to 30 seconds. Because of a low
hit rate, it is relatively improbable, however not impossible, that real
communication is created between the callers.
In everyday life this connection is a means to an end as we are interested
in what the other person has to say. It is different here: the duration
of a connection only lasts long enough to build itself up. It is not
important what connects the two destinations, but rather that there
is a random connection generated that is acoustically perceivable.
The work is of a very plain quality because only the computer monitors
are of artistic interest.
What you see there is a kind of membrane between the merely sensual,
physiological and empirical world and the world of electronic data on
which we naturally depend in reality, even though our insight and access
might be restricted. With this work people gain insight into the nearly
unlimited possibilities of connections within the international telephone
network.
In contrast to consciously dialing a connection, it is an independent
random number generator that decides on the numbers, thus taking over
the role of the operator mediating between the two callers. The two
generators become the active part in the connection of two passive recipients.
They create a permanent tension that can enable human and thus culturally
interesting interactions and invite the visitor to take part as a voyeur.
|