(english)(Vortrag online) Im
Mai ist es genau 100 Jahre her, dass Franz Kafkas Geschichte "Das
Urteil" in Max Brods Jahrbuch "Arcadia" das Licht der literarischen
Welt erblickte. Das kleine, im Originaltyposkript 17 Seiten kurze
Werk war in der Nacht vom 22. auf den 23. September 1912 "wie eine
regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt" aus seinem Urheber
hervorgegangen, wie dieser am 11. Februar 1913 in sein Tagebuch schrieb.
Es blieb zeitlebens die ihm "liebste Arbeit", während er den größten
Teil seines Gesamtwerks später vernichtet sehen wollte. Ein Erfolg
zu Lebzeiten war die Geschichte nicht. Die Arcadia-Auflage von 1000
war auch noch 1919 nicht vergriffen. Da lag allerdings "Das Urteil"
bereits als 80-Groschen-Heft der Nummer 34 in der Edition "Der Jüngste
Tag" im Kurt Wolff Verlag vor, der es in zweiter Auflage seit 1916
höchstens zwei- bis dreitausend mal verkaufte. Heute gilt die Geschichte
als eines der exorbitantesten Werke der Weltliteratur, in dem sich
die Ichzerfallenheit des modernen Menschen wie in keinem anderen davor
oder danach widerspiegelt.
Oberwelt-Mitglied Dr. Gerhard Oberlin ist Literaturwissenschaftler
und mit einem brandneuen Buch "Die letzten Mythen" in der Kafka-Forschung
vertreten.
Samstag, 20. April
Lesung von Susa Ramsthaler 18.15 bis 19.00 Uhr
Vortrag von Dr. Gerhard Oberlin 19.00 bis 20.00 Uhr
anschließend Möglichkeit
zum Gespräch
Gerhard und Ellen Rein haben angeregt, dem Vortrag eine Ausstellung
folgen zu lassen, in der künstlerische Reaktionen auf diese Geschichte
gezeigt werden. Ausstellungseröffnung ist der 19. 7. 2013.
Die Teilnahme steht allen Künstler/innen offen, die sich von dieser
exorbitanten Geschichte künstlerisch inspirieren lassen wollen. Sie
wird hiermit ausgeschrieben. Anmeldeschluss ist der 31. Mai via kontakt(at)oberwelt.de
oder postalisch, auch Performance willkommen, Abgabetermin und Aufbau
sind der 17. und 18. Juli. Die Einführung hält Dr. Gerhard Oberlin.
Fortgesetzt wird das Veranstaltungsformat in der Reihe
"Reflexe"
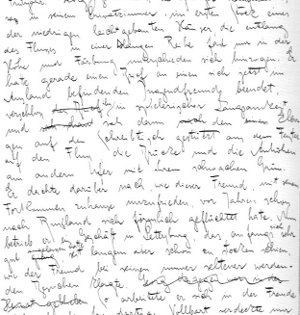


Die
Büchse der Pandora -100 Jahre Franz Kafkas "Urteil"
Susa
Ramsthaler (Lesung) / Dr. Gerhard Oberlin (Vortrag)
Pandora’s Box – 100 years of Franz Kafka’s “Judgement"
Susa Ramsthaler (Reading) / Dr. Gerhard Oberlin (Lecture)
In May 2013, it will be exactly 100 years since Franz Kafka’s story
“The Judgement” saw the literary light of day in Max Brod’s yearbook
“Arkadia”. The short work, only 17 pages in original typescript, emerged
from the author on the night of September 22nd, 1912 “as a true birth,
covered with filth and slime”, as he stated in his diary on February
11th, 1913. It remained his lifelong “favourite work”, whereas he
later wished to have most of his other works destroyed. The story
was not blessed with success during his lifetime. In 1919, there were
still unsold copies of the original Arkadia print run of 1000. However,
“The Judgement” was also available as number 34 in the series of dime
novels entitled “Der Jüngste Tag” (English: Judgement Day) published
by the Kurt Wolff Verlag. Between two and three thousand copies of
this second edition were sold from 1916. Today the story is regarded
as one of the most exorbitant works of world literature as the self-disintegration
of the contemporary individual is reflected in it as in no other work
past or present.
The Oberwelt member Dr. Gerhard Oberlin is literary scholar and author
of the recently published analysis of Kafka’s works entitled “Die
letzten Mythen” (English: The last Myths)
Gerhard and Ellen Rein proposed the lecture be followed by an exhibition
presenting artistic responses to Kafka’s “The Judgement”.
Exhibition opening: 19.7.2013, 7.15 pm
Participation is open to all artists who wish to be artistically inspired
by this exorbitant story. This is the official call for entries. Registration
by email (kontakt(at)oberwelt.de) or mail till May 31st, 2013, performances
welcome. Submission and installation of works July 17th/18th. Introductory
talk to be held by Dr. Gerhard Oberlin.
Vortrag von Gerhard
Oberlin
Die Büchse der Pandora - 100 Jahre Franz
Kafkas Das Urteil
„Das Vorhaben, die Geschichte des Menschen zu verstehen,
wird so lange scheitern, wie wir nicht in der Lage sind, das
Allgegenwärtige des Fremden in uns zu erkennen. Die Einsicht ist versperrt,
weil wir den Terror und das Leid, denen wir ausgesetzt waren, verleugnen
müssen. Diese Verschüttung der Quellen des Opferseins führt dazu,
dass der Gehorsam immer wieder inszeniert und weitergetragen wird.
Dabei ist das Perfide am Gehorsam seine eingebaute Sicherung: Gegen
ihn zu verstoßen bedeutet, mit Schuld überladen zu sein. Zugleich
halten wir uns für frei und autonom.“
Arno Gruen (2004, 54)
Das Urteil in der 1916 in Leipzig erschienenen Ausgabe des
Kurt
Wolff Verlags mit der Widmung „Für F.“: Es ist ein 29 Seiten
dünnes Heftchen, die Nummer 34 in der berühmt gewordenen,
durch den Materialmangel im Krieg verursachten einheitlichen
Gestalt der Reihe Der jüngste Tag: schwarzer Umschlagkarton
mit aufgeklebtem hellblauen Deckelschildchen.
Mit der Reihe wollte Kurt Wolff von 1913 an dafür sorgen, dass
„Schöpfungen der jüngsten Dichter, hervorgebracht durch das
gemeinsame Erlebnis unserer Zeit [...] zu billigstem Preise in
weiteste Kreise dringen“. Das ist ihm nicht gelungen. Das mit
1000-2000 Exemplaren aufgelegte Urteil erlebte zwar im
Sommer 1919 eine Nachauflage, doch dürfte von ihr nur ein
Teil verkauft worden sein, so dass vermutlich weit weniger als
3000 Exemplare insgesamt für den Spottpreis von 80 Pfennig
unters Volk kamen.
Das Urteil war in einer einzigen Nacht entstanden, nämlich
vom
22. auf den 23. September 1912, nach Kafkas eigenen Angaben
„von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug“ (T 460). An
der ästhetischen Eichlatte und der euphorisierenden Wirkung
auf den Autor gemessen, ist es praktisch ein Erstlingswerk,
obwohl hochwertige Texte auch davor verfasst wurden, später
zusammengefasst in den Hochzeitsvorbereitungen auf dem
Lande oder Beschreibungen eines Kampfes. Knapp 4 Jahre
später wird er an Kurt Wolffs Vertreter Georg Heinrich Meyer
schreiben: „Das ›Urteil‹, an dem mir eben besonders gelegen
ist, ist zwar sehr klein, aber es ist auch mehr Gedicht als
Erzählung, es braucht freien Raum um sich und ist auch nicht
unwert ihn zu bekommen.“ (B III 201) Es war sein erstes Werk,
dem er „Zweifellosigkeit“ (T 463) bescheinigte. Sein erstes
Heureka! - und das nach Hunderten von Seiten, die in knapp 15
Jahren entstanden waren und im Papierkorb landeten; nach der
ersten Fassung des Amerika-Romans und den schon
erwähnten, über 8 Jahre verteilten kleineren Arbeiten, von
denen acht kleine Prosastücke in der Zeitschrift Hyperion
veröffentlicht waren. Kafka war inzwischen 29 Jahre alt, er
blickte auf eine fünfjährige Praxis als Versicherungsjustitiar und
Spezialist für Arbeitsunfälle zurück. Ein Gefühl plagte ihn, dass
sein Leben nutzlos vergehe, wenn er es nicht dem Schreiben
widme. Das Jahr 1912 brachte mit dem Urteil nach heutiger
Sicht den Durchbruch und die (vorübergehende) Wende, wenn
sich auch an den Lebensumständen des Autors nichts änderte.
In seiner wohl produktivsten Arbeitsperiode wird nun der
„amerikanische Roman“ in einer Neufassung unter dem Titel
Der Verschollene auf mehrere hundert Seiten vorangetrieben.
Kafka dachte in diesem Jahr zum erstenmal an eine
Buchpublikation.Er hatte am 14. August an Ernst Rowohlt
geschrieben und ihm ein „kleines Buch“ in Aussicht gestellt. Es
erschien im selben Jahr unter dem Titel Betrachtung mit 18
Prosaskizzen in einer Auflage von 800 nummerierten
Exemplaren.
In jenem regnerischen, kalten Sommer 1912 hatte er eine
Woche in Weimar, danach drei Wochen in ›Just‘s Jungborn‹,
einem FKK-Freiluftsanatorium zwischen Harzburg und Ilsenburg
im Harz, verbracht. Wieder zurück in Prag, hatte er noch im
August auf einer Gesellschaft die Prokuristin Felice Bauer
kennen gelernt, seine spätere Verlobte (bis Ende 1917), die aus
Berlin zu Besuch kam und bei seinem Freund Max Brod
verkehrte. Ihr widmete er dann auch Das Urteil. Das Werk
ist
ein Reflex auf die sich real anbahnende Geschichte: die eines
Junggesellen, der ein erfolgreicher Versicherungsjurist und
erfolgloser Schriftsteller ist; der in einer bestimmten
Konstellation seines Lebens eine Frau trifft, die seine
bürgerlichen Fantasien entzündet und seine unbürgerlichen
desillusioniert. Dass die Frau Felice heißt (also Glück verspricht)
und dass sie mit dem Nachnamen Bauer für eine gewisse
Bodenständigkeit steht, passt zur Zwiegespaltenheit Kafkas in
Sachen Liebe und induziert Hochspannung.
Erst zwei Tage vor der Niederschrift hatte er seinen ersten Brief
an Felice geschrieben. Bei seiner chronischen Bindungsangst
bedeutete Verliebtsein Alarm, Aufgewühltsein. Ihre Initialen
fließen samt den Anklängen an "Bauer" in den Namen der Braut
ein: Frieda Brandenfeld. Kafka wird das später bewusst. Noch
immer wohnt er in der Wohnung der Eltern (das wird sich erst
in seinem 31. Lebensjahr für kurze Zeit ändern). Er wohnt in
der Niklasstraße 36 im fünften und obersten Stock des
Eckhauses ›Zum Schiff‹. Das liegt direkt am Brückenkopf der
damals neuen Čechbrücke. Der Blick vom Fenster seines
Zimmers geht über die von vier engelgekrönten Säulen
flankierte Brücke mit Tramlinie und Mautstation auf die
Grünanlagen des Belvedere-Plateaus und die Kronprinz-Rudolf-
Anlagen. Es ist dieser Blick auf die Moldau und die Straße
dorthin hinab, der ihm einige Male in diesem Jahr das
Selbstmordszenario eingab. So auch Anfang Oktober 1912,
zwei Wochen nach dem Durchbruch: „Ich bin sehr lange am
Fenster gestanden, und es hätte mir öfters gepasst, den
Mauteinnehmer auf der Brücke durch meinen Sturz
aufzuschrecken.“ Vier Jahre davor hatte er geschrieben: „Ich
passte vorige Woche wirklich in diese Gasse, in der ich wohne
und die ich nenne ›Anlaufstraße für Selbstmörder‹, denn diese
Straße führt breit zum Fluss, da wird eine Brücke gebaut“ – die
eben erwähnte Čechbrücke.
Im Urteil blickt nun ein scheinbar abgeklärter Georg
Bendemann ebenfalls „aus dem Fenster auf den Fluss, die
Brücke und die Anhöhen am anderen Ufer“. Wir sind am Anfang
der Erzählung und genau 24 Textseiten von seinem Selbstmord
entfernt. Der geschieht nicht als Fenster-, sondern als
Brückensturz und auf den ersten 16−17 Seiten ist davon nichts
zu ahnen. Erst mit dem „Nein!“ des scheinbar
abgewirtschafteten Vaters ändert sich alles, als er ihn ins Bett
legt und mit der zweideutigen Bemerkung beschwichtigt: „Sei
nur ruhig, du bist gut zugedeckt“. Dann geht alles sehr schnell.
Es fängt also sehr harmlos an und wird dann plötzlich sehr
ernst, oder es kratzt ein wenig an der Oberfläche und wird dann
plötzlich sehr ›tief‹.
An Felice Bauer, die Muse des kleinen Werks, schreibt Kafka am
3. Juni 1913: „Findest Du im Urteil irgendeinen Sinn, ich meine
irgendeinen geraden, zusammenhängenden, verfolgbaren Sinn?
Ich finde ihn nicht und kann auch nichts darin erklären.“ (B I
201) Ein paar Tage später kommt er zum Schluss:
„Das ›Urteil‹ ist nicht zu erklären. [...] Die Geschichte steckt
voll Abstraktionen, ohne dass sie zugestanden werden. Der Freund ist
kaum eine wirkliche Person, er ist vielleicht eher das, was dem Vater
und Georg gemeinsam ist. Die Geschichte ist vielleicht ein Rundgang
um Vater und Sohn und die wechselnde Gestalt des Freundes ist vielleicht
der perspektivische Wechsel der Beziehungen zwischen Vater und Sohn.
Sicher bin ich dessen aber auch nicht.“ (B I 205)
Dreimal "vielleicht": Offensichtlich kann (oder will) der
Autor
die Geschichte selbst nicht erklären. Er weiß aber: nur so und
nicht anders ist es richtig. Die Intuition erweist sich als größer
denn alle Vernunft. Oder: sie findet erstmals die Zustimmung
des Verstands, weil sie unbeirrt ist - und das ohne Erwähnung
der Psychologie . Seine Unfähigkeit zur psychologischen
Deutung scheint gerade eine der Voraussetzungen für das
Entstehen dieser Geschichte im Sinn eines ›Geschehenlassens‹
zu sein. Gleichwohl hält er er am 23. September 1912 im
Rückblick auf die Niederschrift fest: „[...] Gedanken an Freud
natürlich [...].“ (T 461)
Eines war ihm aber wohl bewusst: dass mit dem Feld der Liebe
der wahre Schauplatz eines jeden Psychodramas und darüber
hinaus das Schlachtfeld der Sozialisation betreten wird:
„Folgerungen aus dem ›Urteil‹ für meinen Fall“, schreibt er am
14. August 1913 - und das erweist sich als hellsichtig: „Ich
verdanke die Geschichte auf Umwegen ihr [Felice Bauer, Vf.].
Georg geht aber an der Braut zugrunde.“ (T 574) Aus seinem
Tagebucheintrag vom 11. Februar 1913 lässt sich erkennen,
wie sehr er darum rang, das eigene Innere überhaupt auf die
Welt zu bringen, und wie abstoßend die eigene Innenwelt, wie
abstoßend allein schon die Introspektion als solche ihm
erschien. Die Geschichte, schreibt er dort, sei „wie eine
regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt“ aus ihm
herausgekommen (T 491). Der „Freund“ in Petersburg trägt die
Merkmale jener „Geburt"; er ist Bendemanns alter ego inferior
oder, um es mit den Worten Arno Grüns zu sagen: der Fremde
in ihm.
Sehen wir uns die Entwicklung im Handlungsverlauf einmal
näher an. Am Anfang steht ein bürgerlicher Scheinfriede, ein
Schönwettersonntag im Frühling. Georg Bendemann hat seinem
nach Russland emigrierten Freund endlich die Verlobung
mitgeteilt. Er verschließt den Brief und blickt aus dem Fenster
vermutlich auf jene Čechbrücke. Er scheint mit sich zufrieden.
Der Freund ist im (fast peinlichen) Gegensatz zu ihm ein
Gescheiterter, einer, „der sich offenbar verrannt hatte“, wie es
heißt; einer, dessen Geschäfte nicht gut gingen und der sich
„für ein endgültiges Junggesellentum ein[richtete]“ (U 6).
Georg hat ihm die Verlobung "angezeigt", wie es im
konventionellen Jargon heißt. "Die beste Neuigkeit",
schreibt er,
habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. Ich habe mich mit einem
Fräulein Frieda Brandenfeld verlobt, einem Mädchen aus einer wohlhabenden
Familie, die sich hier erst lange nach Deiner Abreise angesiedelt
hat, die Du also kaum kennen dürftest. Es wird sich noch Gelegenheit
finden, Dir Näheres über meine Braut mitzuteilen, heute genüge Dir,
dass ich recht glücklich bin und dass sich in unserem gegenseitigen
Verhältnis nur insofern etwas geändert hat, als Du jetzt in mir statt
eines ganz gewöhnlichen Freundes einen glücklichen Freund haben wirst.“
(U 12)
Auch der psychologisch ungeschulte Leser nimmt in diesen
blutleeren Zeilen das Zittern wahr, das in Bendemann vorgeht.
Der Lügendetektor hätte heftig ausgeschlagen. Nicht, weil es
gelogen wäre, sondern weil es gar nicht Bendemann ist, der da
schreibt. Und: weil der Freund nicht der Freund ist. Beide
Figuren sind auch der jeweils andere, ergänzen sich zu einer
Person. So ist der Peterburger der spiegelbildlich andere
Bendemann - und umgekehrt. Er steht für Einsamkeit,
Misserfolg, Heimatlosigkeit, Selbstentfremdung: für den
Alptraum des Scheiterns eines erfolgreichen Bürgers und
Geschäftsmanns. Bendemann-junior auf der anderen Seite
entspringt einem diametral entgegengesetzten Alptraum: dem
vom Opportunismus, der Erfüllung standardisierter
Rollenideale, der Übersozialisation und Selbstentfremdung.
Die hohlen Phrasen in diesem Brief sind nichts als
Tagesordnungs- und Selbstbeschwichtigungsgeschätz
angesichts gewisser Melancholien, die alte Gefahren
heraufbeschwören (des Scheiterns, der Verführung etc.): eine
Situation, die an das opening von Goethes Faust denken lässt,
wenn ein kollektives Subjekt in der Zueignung sinniert: "Ihr
naht euch wieder, schwankende Gestalten!/Die früh sich einst
dem trüben Blick gezeigt." Bendemanns bürgerliche Existenz
lässt durchscheinen, aus welchem Stoff sie gemacht ist: den
Mühen des Genügens, den Schmerzen des Verbiegens, dem
Verzicht auf vitale Selbsterfüllung in Lust und Leid. Der
Arrivierte dreht sich um und sieht die Durststrecke, auf der er
gekommen ist, spürt dabei, wie Goethe, "ein längst entwöhntes
Sehnen/ Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich". Das Nahe
wird plötzlich fern und das Weite kommt gefährlich nah: "Was
ich besitze seh ich wie im Weiten,/Und was verschwand wird
mir zu Wirklichkeiten." Der Firmenchef, die schwarzen Zahlen
der Buchhaltung, sogar die Braut: Ideenwelten mehr als
Realitäten, Abstraktionen des Wohlsituierten, gut Angepassten.
Der Petersburger Freund im fernen Russland: Wie wird er
beneidet, wie wird er bemitleidet. An ihm kritallisiert sich
Selbstmitleid und Frustration spiegelbildlich, umgekehrt
proportional. Die seitenlange Reflexion über des Freundes
Misserfolge im Ausland nennt nirgends geschäftliche Gründe für
dessen Scheitern. Seine Kränklichkeit scheint dafür
verantwortlich. Daneben der selbstgerechte Standpunkt, dass
in „der Fremde“ nichts gelingen kann: „So arbeitete er sich in
der Fremde nutzlos ab, der fremdartige Vollbart verdeckte nur
schlecht das seit den Kinderjahren wohlbekannte Gesicht,
dessen gelbe Hautfarbe auf eine sich entwickelnde Krankheit
hinzudeuten schien.“ (U 6) Heute würde man das Wort loser
verwenden, das ja unterstellt, der Misserfolg sei ein Desaster
und eine Dummheit obendrein. Der Petersburger sei eben, so
heißt es, „ein altes Kind [...] und [habe] den erfolgreichen, zu
Hause gebliebenen Freunden einfach zu folgen“, wenn er sich
zurückverirrte. Bei diesem Jugend-alter ego kann Georg
Bendemann sich nicht nur keinen ›Erfolg‹ (von folgen),
sondern
auch keine reife Entwicklung vorstellen. Besonders in dieser
›Zurückgebliebenheit‹ wird der Freund als Pendant erkennbar,
das dem „junge[n] Kaufmann“ (U 5) sein wahres Seelenalter
zurückwirft. In dem Petersburger Zerrbild erscheint Bendemann
gewissermaßen physikalisch gebrochen (to bend). Was an ihm
menschlich genuin sein mag, aber eben nicht opportun ist,
gleicht einer vorzivilisatorischen Kopie, einem idealen "Ur-Ich"
vor aller Normierung in den Prägestöcken der kapitalistischen
Geschäftswelt. In seinem Licht muss sich nun der
geschäftstüchtige Bendemann wie ein Versager vorkommen,
der allerdings gesellschaftlich recht hat (deshalb zeigt der
Projektionspfeil auch in die Fremde). Zu seiner geistigen
Heimat gehören neben dem Wertdenken des Geschäftsmanns
und der Braut, mit der er „recht glücklich“ ist (U 12), das ganze
Inventar an verabredeten Durchschnittlichkeiten, die in einer
Massengesellschaft vitale Ereignisse ersetzen. Weil ihm das
angepasste Leben materiellen und sozialen Erfolg beschert und
die kindliche Versagersuggestion (oder den Versagerfluch) auf
Abstand hält (solange der Petersburger Freund nicht ins Haus
steht), richtet er sich darin ein. Der Freund liefert ihm die
Kontrastfolie, die auf diese innere Distanz noch nicht gefährlich
wird. Ihre Ausstattung mit negativen Vorzeichen hilft ihm die
Mühen des Opportunismus rechtfertigen. Das Gegenbild des
Unmaskierten und offenbar Unmaskierbaren − „der fremdartige
Vollbart verdeckte nur schlecht das seit den Kinderjahren
wohlbekannte Gesicht“ (U 6) − wurde ihm bei aller
Entfremdung zu einem Gegengewicht, dem er, wenn man so
will, sein Gleichgewicht verdankt, und wurde so zum Alibi für
die verpasste Selbstverwirklichung.
Den schwierigen Zusammenhalt der Gegensätze drückt Kafka
also in dieser Doppelgängerkonstruktion aus, die den
eigentlichen Konfliktgenerator der Erzählung bildet. Georg −
das verrät seine unpersönliche Sprache – ist in seinem
Erwachsenenleben ein Massenstereotyp geworden, das eines
Tages wieder nach Menschsein verlangt und spürt, dass es aus
der Komplizenschaft mit der normierenden Autorität
hervorgegangen ist. Als er das Zimmer seines Vaters betritt,
um ihm zu sagen, „dass [er] nun doch nach Petersburg [s]eine
Verlobung angezeigt habe“ (U 15), ist er noch ganz
Bendemann-Junior, der es geschafft hat, nach dem Tod der
Mutter, vor allem dem damit verbundenen Rückzug des Vaters
aus den vorderen Reihen der Firma, das Personal zu verdoppeln
und die Umsatzzahlen zu verfünffachen. Im Zimmer ist es
dunkel, der Schatten einer hohen Mauer fällt auf das Fenster.
Das Privileg der Aussicht auf den Fluss hatte er, der Sohn, sich
angemaßt, der aber nun, geplagt von Gewissensbissen, dem
Vater den Tausch anbietet. „[M]ein Vater ist noch immer ein
Riese“ (U 14), wundert er sich, hat er ihn doch „schon seit
Monaten“ (U 13) nicht mehr in seinem stickigen Zimmer
besucht. In dem „noch“ kommt das noch nicht ganz geklärte
Größenverhältnis zwischen den beiden zum Ausdruck: Georg
überragt seinen Vater, aber eben doch „noch“ nicht genug, um
zu triumphieren. Schwächemerkmale, wie sie der Freund
aufwies, erscheinen nun auch beim Vater. Sie sind von
Bendemann-Junior gern gesehen, sind sie doch die Trophäen
seines Sieges. Konkret hat der Vater „irgend eine
Augenschwäche“ (U 14) und einen „zahnlosen Mund“ (U 16),
dazu ein „müdes Gesicht“ unter „struppige[m] weißen Haar“ (U
19).
Es überrascht uns deshalb nicht, wenn wir den Vater bald sagen
hören: „Wohl kenne ich deinen Freund. Er wäre ein Sohn nach
meinem Herzen.“ (U 22) Das sagt er jetzt, wo er auf dem Punkt
der Wahrheit ist, und wir ahnen: Auch für den Vater war der
Freund einst ein ungeliebter Sohn. Das war vor drei Jahren,
als
er noch selbst Patriarch der Familie und unangefochtener
Firmenchef war und jenen Freund bei dessen Besuch in der
Heimat seine „Abneigung“ (U 20) spüren ließ – ja, Patriarch der
Familie war er überhaupt nur, solange er den Freund in der
Fremde wusste: auch dieser also ein entfremdetes alter ego
des
Vaters. Mit dem Tod der Frau setzte ihn dann aber die Trauer
auf Erinnerung und spülte Urgestein herauf. Menschliches
Gebrechen lernt er nun überhaupt erst kennen. Erst im
Bindungsverlust geht ihm die Dimension der Liebe auf. Der
Freund wurde also auch ihm zum Spiegelbild – oder das
Spiegelbild zum Freund: letztere Option hält Kafka ausdrücklich
bereit, indem er den Vater die Existenz eines realen oder doch
im landläufigen Sinne ›wirklichen‹ Freundes bestreiten lässt:
„Du hast keinen Freund in Petersburg.“ (U 19)
An dieser Stelle im Text folgen Vorwürfe des Vaters, Georg
habe den Freund deswegen betrogen, weil dieser „ein Sohn
nach [s]einem Herzen“ gewesen sei, und es sei ihm nur darum
gegangen, ihn ›unterzukriegen‹, um zu heiraten (U 23).
Eifersucht also kommt ins Spiel, um Liebe oder Nicht-Liebe geht
es jetzt in erster Linie, und damit sind wir am Punkt der
Wahrheit und am Angelpunkt der Psychomechanik, die alles auf
das tragische Ende hin beschleunigt. Im Augenblick seines
Triumphs, als der Vater „aufrecht im Bett“ steht – eben hat er
noch wie ein Kleinkind mit Georgs Uhrkette gespielt -, ist sein
„Schreckbild“ eine Mischung aus Offenbarung, Selbstbetrug und
grausam-taktischer Liebeserklärung (U 22f.). Der Vater prahlt
nicht einfach mit seiner Vitalkraft, als erhöbe er jetzt Anspruch
auf die frühere Herrschaft, sondern er spielt sich auf, um
seinem Sohn die Wahrheit zu sagen. Das hat zur Folge, dass
der in völlige Konfusion ›stürzt‹. Er gesteht ihm seine
enttäuschte Vaterliebe, er bezichtigt die Braut gemeiner
Verführungskünste und ihn selbst der Befriedigung sexueller
Lüste. Dann hält er ihm vor, er habe der „Mutter Andenken
geschändet“ (U 24). Das ist eine verräterische Formulierung, in
der sich der Vater selbst als "altes Kind" zu erkennen gibt,
wenn er die Ehefrau als „unsere[]“ Mutter bezeichnet. Diese
Eigenschaft war für den Petersburger Freund schon reserviert,
geht aber nun auf ihn über, da der Vater sich mit diesem in
dessen Schwäche identifiziert: „[...] der Freund geht zugrunde
in seinem Russland, schon vor drei Jahren war er gelb zum
Wegwerfen, und ich, du siehst ja, wie es mit mir steht.“ (U 28)
Er wirft ihm sein gesellschaftliches Leben vor, die Maskerade,
die Georg überhaupt erst nach außen handlungs- und
geschäftsfähig machte: „Und mein Sohn ging im Jubel durch die
Welt [...] überpurzelte sich vor Vergnügen und ging vor seinem
Vater mit dem verschlossenen Gesicht eines Ehrenmannes
davon!“ (U 25) Schließlich sagt er ihm auf den Kopf zu, er sei
unreif, und das in einer Formulierung, die einer absurden Logik
folgt: „Wie lange hast du gezögert, ehe du reif geworden bist!
Die Mutter musste sterben, sie konnte den Freudentag nicht
erleben [...].“ (U 27f.) Hier soll der Sohn die Verantwortung
nicht nur für seine verhinderte seelische Reife übernehmen,
sondern auch – über eine assoziative Falle – für den Tod der
Mutter: eine doppelte und doppelt unmögliche Bürde für einen
Menschen. Das ist argumentative Hexenkunst, die den Vater in
seiner infantilen Abhängigkeit besser charakterisiert als seine
theatralischen Posen. Sie äfft Georg in Ermangelung der
Argumente – auf welche Logik soll er denn antworten? – nur
noch ohnmächtig nach, wobei auch er vollends sein
erwachsenes Gesicht verliert.
Die Braut wird in dieser Erzählung zum Testfall der psychischen
Gesundheit der Figuren. Sie selbst tritt als Handelnde zwar
nicht in Erscheinung, ist aber umso präsenter als psychische
Energie. Kafkas Verwirrspiel sorgt dafür, dass wir es nicht nur
mit einer, sondern gleich mit mehreren Eifersuchten zu tun
haben. Vater Bendemann ist eifersüchtig auf Georg, dessen
Braut er auf ihre Geschlechtsmerkmale reduziert („weil sie die
Röcke gehoben hat“); damit verrät er freilich sein erotisches
Interesse als Nebenbuhler. Eifersüchtig ist er auch auf die
Braut, die ja nun ins Familiengefüge eingreift. Sie stört das
mühsam eroberte Gleichgewicht und droht ihm den Sohn (und
damit auch das Produkt seiner eigenen Frau) wegzunehmen,
und das in einer Situation, wo er zum "alten Kind" degenerierte
und sich Georg schon unterworfen hat. Das Dritte, was ihn
eifersüchtig macht, ergibt sich aus dem Blickwinkel seiner Frau,
in deren Andenken er lebt. Aus diesem Blickwinkel ist er
eifersüchtig auf die Braut, als deren ›Nebenbuhlerin‹ er sich
fühlt. An diese weibliche Eigenschaft erinnert sein Schlafrock,
den er zur Demonstration der Verführungskünste der Braut
hochrafft. Als seien diese Eifersuchten nicht schon genug,
kommt nun noch die Eifersucht der Braut auf den Freund dazu
und die des Freundes auf die Braut.
In diesem Schmelzofen der Eifersuchten ist bald ein Zustand
erreicht, in dem Georgs Ich seine Materialschwäche offenbart
und sich auflöst. Die Braut hat dabei eine auslösende Rolle.
Kafkas Eindruck, "Georg geht aber an der Braut zugrunde"
(T,
S. 574), ist also richtig, wenn die Braut auch nicht der einzige
Grund ist. Man könnte sagen, dass sie der Zünder ist, der die
bewusste Aufspaltung erst ermöglicht. Im Medium des
Erotischen kommen eben alle Emotionen ans Licht. Das
Unbewusste wird virulent. Die Wahrheit der Seele lässt sich
nicht mehr verbergen. Die Braut ist gewissermaßen der
Ernstfall der Selbstoffenbarung.
In dieser Geschichte begegnet uns ein Konfliktmodell, das nicht
einseitig Opfer- und Täterrolle an Vater und Sohn vergibt,
sondern das beiden Figuren beide Rollen zuweist. Es ist nicht in
erster Linie ein Modell des individuellen Scheiterns. Letztlich
läuft ja doch alles auf eine Sabotage des natürlichen
Generationenwechsels hinaus. Nicht Regeneration, sondern
Degeneration findet hier statt! Das ist also mehr als ein
„Widerstreit zweier Generationen“, wie Milena Jesenskà in
ihrem Nachruf auf Franz Kafka schrieb (MI 380). Und obwohl
Parallelen zu gewissen Initiationsritualen bei indigenen Kulturen
ins Auge fallen, etwa der regressus ad uterum im „Tode des
Ertrinkens“, geht die Geschichte in Initiationssymbolik nicht
auf. Das emotionale Erwachsenwerden Georg Bendemanns hat
unter diesen Umständen schließlich keine Chance.
Welch gewaltiges Potential an Destruktivität in einer Struktur
wie dieser schlummert, wenn sie kein Einzel-, sondern der
Kollektivfall ist, das lässt die Geschichte der industrialisierten
Länder erahnen. An diese Geschichte lässt der gleichgültige
Strom des Verkehrs denken, der Georgs Fall übertönt. Es ist ein
letzter sinnloser Dialogversuch, wenn seine letzten Worte
zweimal von Liebe sprechen, und zwar an die Adresse seiner
Eltern, die das nicht hören können: "Liebe Eltern, ich habe euch
doch immer geliebt".
Es ist für die psychoanalytische Brille klar, dass Momente des
Ödipusmythos in dieser Erzählung strukturbildend sind. Es kann
darüber hinaus aber gezeigt werden (und das tun wir heute
zum erstenmal!), dass der mythologische Leitgedanke im
Prinzip dem Prometheusmythos folgt. Das Urteil besetzt alle
Rollen der mythischen Vorlage. Georg Bendemann ist ein
Prometheus, der von Göttervater (oder Vatergott) Zeus als
Rebell befehdet, von einem Bruder namens Epimetheus (dem
Freund) und einer Pandora (der Verlobten) sabotiert wird und
der dann im Aufstand gegen die Opferaltäre der Väter sein
Lebensrecht verliert. Die Fronten verlaufen hier nicht klar
zwischen Freundes- und Feindesland, ja nicht einmal entlang
einer bestimmten Kampflinie; sie sind nicht eindeutig auf
verschiedene Subjekte verteilt, sondern sie spalten ein und
diesselbe Person in psychische Parteien. Analog bilden sich
monströse Personalunionen, die jeden Identitätsbegriff
überfordern: Der Rebell verschmilzt mit dem Herrscher, der
Herrscher kollaboriert mit dem Aufständischen. Jeder trägt den
andern in sich und bekämpft sich selbst: ein Bild der Psyche in
ihren Kämpfen, besonders in autoritären Verhältnissen. Ein Bild
der Psyche von einer archaischen Wucht, die nach dem
Vergleich mit den Gigantomachien der (antiken) Mythen ruft.
Die letzten Anklänge an eine (kosmologische) Ordnung gehen
in diesem Wirrwar verloren – und doch hat selbst dieses Chaos
noch seine Ordnung. Das beweist Kafkas Geschichte in ihrer
ästhetischen Qualität und ihrem wider alle Abrede behaupteten
"verborgenen Sinn". Georg Bendemann, der Freund, der Vater:
sie alle sind wie ein Gewölbe mit seinen Kraftgegensätzen eins
− bis eine vierte Kraft die statischen Verhältnisse zum Kippen
bringt.
Im Mythos ist Pandora die Gegenkraft, die dem schwachen
Epimetheus durch göttliche Intervention untergeschoben wird.
Der nimmt sie trotz der Warnungen seines Bruders ihrer Reize
wegen zur Frau. Damit ist, so oder so, das Unheil in die Wiege
der Familie gelegt. Die Eva prima, die Frau par excellence, kann
im Haus des Rebellen als dessen Verwandte den desto größeren
Schaden anrichten, als sie nun in der Sphäre der Menschen
wirkt, deren Eden sie mittels ihrer Büchse (der einstmaligen
Schlange) zerstört. Pandora, die Allesgeberin, wird zur
Allesnehmerin. Sie hat das letzte Wort und ist die späte Rache
des Göttervaters (oder Vatergottes), der Prometheus für sein
Rebellentum bestraft. In Kafkas Adaption scheitert, genau
genommen, kein Prometheus beim Versuch eine neue
Kosmologie zu gründen, sondern eine neue Kosmologie – die
der Götterdämmerung - scheitert daran, einen Prometheus zu
finden, der die Partei der Menschen ergreift. Der
Kaukasusfelsen, an dem noch der griechische Titan letzten
Endes seine Befreiung durch Herakles erfährt, wird zum
endgültigen Grab. Der Mensch verliert damit seinen Ziehvater
und Verbündeten und bleibt sich selbst überlassen.
Man hat vom Anthropozän gesprochen als dem Zeitalter des
Menschen nach dem Holozän, dem Zeitalter, in dem der Mensch
in den Weltenlauf eingreift. Kafka hat dazu seine dezidierte
Meinung gesagt in seinem "Bericht für eine Akademie". Der
Weg vom Affen zum Menschen ist sowohl im Allgemeinen wie
im Besonderen (als Prozess der Zivilisation, als Sozialisation)
eine Sackgasse, eine von Degeneration begleitete
anthropologische Entgleisung. Der Affe Rotpeter betrachtet
seine Menschwerdung als notwendiges Übel, als Strategie der
Assimilationsvernunft. Geschrieben wurde das einige Jahre
nach dem Urteil, als der Kriegslärm des Ersten Weltkriegs nach
Prag drang, wo Kafka einen Steinwurf vom Hradschin in der
Alchemistengasse seine "Arbeitswohnung" hatte. Zu der
Mythenfigur Prometheus merkt er an:
"Von Prometheus berichten vier Sagen. Nach der ersten wurde
er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus
festgeschmiedet und die Götter schickten Adler, die von seiner immer
nachwachsenden Leber fraßen.
Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor den zuhackenden
Schnäbeln immer tiefer in den Felsen bis er mit ihm eins wurde.
Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen,
die Götter vergaßen, die Adler, er selbst.
Nach der vierten wurde man des grundlos Gewordenen müde. Die Götter
wurden müde, die Adler. Die Wunde schloss sich müde.
Blieb das unerklärliche Felsgebirge.“ (N II 69f.)
Zu hinterfragen ist nichts von alledem: "Die Sage versucht das
Unerklärliche zu erklären; da sie aus einem Wahrheitsgrund
kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden." Auch heute
abend war nichts zu hinterfragen, allenfalls zu zeigen – und zu
hören sowieso (ich meine die Lesung von Susa Ramsthaler).
Kafkas Jugendfreund Willy Haas schrieb in der Zeitschrift Forum
1957:
"Kafka hat alles gesagt, was wir zu sagen hatten und nicht
gesagt haben, nicht sagen konnten. [...] Ich kann seine Bücher wie
im Traum lesen. Ich begreife nicht, was es an ihnen zu erklären gibt.
Hinter diesen Geschehnissen stehen immer wieder nur sie selbst, nichts
anderes." (E, S. 83)
Für manche von uns ist das wie bei einem Musikstück, das wir
hören oder selbst spielen. Wir finden es gut und irgendwie
bedeutsam. Es geht uns unter die Haut oder ans Herz. Es
erschüttert uns bis ins Mark und treibt uns Schauer über den
Rücken. Es ist klar, dass es in uns, ja von uns handelt. Aber wir
könnten nicht sagen, warum. „Findest Du im Urteil irgendeinen
Sinn, ich meine irgendeinen geraden, zusammenhängenden,
verfolgbaren Sinn? Ich finde ihn nicht und kann auch nichts
darin erklären“ (B I 201), sagt Kafka. Der Dichter, sagt Kleist
(den Kafka verehrt), "kann auch das sagen, was er nicht sagt"
(1993, S. 757) – und ist sich dessen kaum bewusst (ergänzen
wir). "Mutato nomine de te fabula narratur", sagt Horaz.
"Unter
anderem Namen, handelt die Geschichte von dir."
©Oberlin

